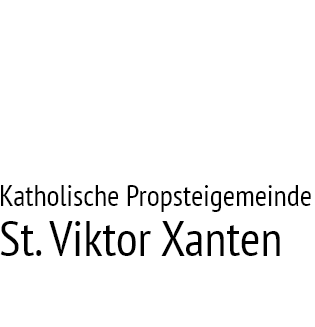13. Sonntag im Jahreskreis
„Komm, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt.“ (Mk5 23) - Gott hält sich nicht distanziert von Leid und Tod.. Er lässt sich hineinziehen in unsere Wirklichkeit, wo gelitten und gestorben wird. Er lässt uns nicht allein damit. Wir sehen als Glaubende Sterben und Tod in einem anderen Licht. Wir dürfen annehmen, dass Gott auch in den dunklen und dunkelsten Stunden bei uns ist. Das ist die Antwort des Evangeliums auf die lastende Frage nach Tod und Leid. Beides wird dadurch nicht abgeschafft – weil zumindest das Sterben natürlicherweise zu unserem Leben gehört. Aber wir können anders umgehen mit beidem: wir werden nicht fortgerissen aus Gottes Hand. Das lässt sich, denke ich, nur erbeten. Und dann erfahren. Und vielleicht erzählen. Ich wünsche mir und Ihnen diese Hoffnungskraft.
Stefan Notz
(in der Zeit der Sommerferien Juli/ August mache ich eine Pause mit den Gedanken zum Sonntag. Allen eine gute Sommerzeit und – hoffentlich – Zeit zur Erholung. Propst Notz)
12. Sonntag im Jahreskreis
„Warum habt Ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?“. (Mk4, 40) Jesus ist mit den Jüngern im Boot. Es tobt ein Sturm. Die Wellen schlagen hoch. Es scheint, als beruhige Jesus wie beiläufig das Meer und den Wind. Den Sturm, das Auf und Ab der Gegenkräfte im Leben, erlebt derjenige als gefährlich, der Angst hat. Die Angst ist das Gegenteil von Glaube. Glaube bedeutet: ich traue Gott. Ganz sicher begegnen auch glaubenden Menschen Gefahren und lebensbedrohende Widerwärtigkeiten. In allem aber wissen sich Glaubende über alle Abgründe hinweg gehalten. Wer glaubt, ist so stark, dass sich der Sturm und die Wogen der Angst vor ihm legen. Wie vor Jesus, weil er Gott ganz traute. Sein gott-menschliches Wort, die Frohe Botschaft von Gott, der uns trägt, wirkt das Wunder, dass der Sturm in uns still wird. Ein solches Vertrauen wünsche ich mir für mich und für uns alle in diesen Zeiten der Unsicherheit und der Zukunftsangst, die viele Menschen bedrücken.
Stefan Notz
11. Sonntag im Jahreskreis
„Durch viele Gleichnisse verkündete er (Jesus) Ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten.“ (Mk 4,26-34) Zwei Gleichnisse erzählt Jesus im Sonntagsevangelium vom Wachstum des Reiches Gottes. Das erste legt den Ton auf das Wachstum der Saat. Der Bauer gibt dem Samen nicht die Kraft des Wachstums. Der Mensch trägt durchaus seinen Teil bei, doch die Hauptarbeit leistet nicht er, sondern Gott, während der Mensch „schläft und wieder aufsteht.“ Das zweite Gleichnis für das Reich Gottes ist ein Beispiel für die zahlreichen Aussagen Jesu, dass das „Kleinste“ im Reich Gottes zum „Größten“ wird, eben weil es sich klein gemacht hat und sich an den „letzten Platz“ gesetzt hat. Jesus spricht hier, denke ich, von sich selbst. Er hat in seinem Erdenleben den letzten Platz eingenommen – am Kreuz. Im Neuen und im Alten Testament haben Gleichnisse nichts mit der Moralität des Menschen zu tun, sondern mit der Erhabenheit Gottes. Im Reich Gottes öffnen sich so viele Möglichkeiten, die alles überbieten, was menschliche Leistung vollbringen kann. Da kann man nur staunen. Das Reich Gottes wächst – „der Mensch weiß nicht, wie“.
Stefan Notz
10. Sonntag im Jahreskreis
Draußen vor dem Haus sind Jesu Mutter und seine Brüder. Jesus fragt: wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder? Jesus lenkt in dieser Szene des Evangeliums (Mk3,20-35) den Blick auf die, die rings um ihn sitzen. Das sind die, die ihm Zeit schenken und ihm zuhören. Eben diese erklärt Jesus zu seiner Familie. „Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.“ Für mich ist das Evangelium eine fortdauernde Einladung zur Schwester oder zum Bruder Jesu zu werden, also in seine Verwandtschaft hinein zu wachsen. Klaus Müller, langjähriger Theologieprofessor in Münster schreibt: „Was ein theologisches Lehrbuch – durchaus richtig - auf einer halben Seite formuliert, das mit dem Herzen zu ergreifen, das kann manchmal 15 Jahre oder länger dauern.“ Schwester und Bruder Jesu kann ich werden, wenn ich staunen kann über ihn, der in dem, was er sagt, was er tut und was er ist deutlich macht, was Gott für uns tut und mit uns vorhat. Ich wünsche mir dieses Wachstum für mich selbst und für unsere ganze Kirche. Einen guten Sonntag wünscht
Stefan Notz
9. Sonntag im Jahreskreis
„Der Sabbat ist im alttestamentlichen Schöpfungsbericht der Höhepunkt der Schöpfungswoche, höchster Feiertag Israels und seine Nichteinhaltung ist Gegenstand schärfster prophetischer Kritik. Sein hervorragendstes Merkmal ist das Gebot der Arbeitsruhe, einzuhalten an jedem siebten Tag.“ So ist es in einem theologischen Fachlexikon zu lesen. In den Lesungen des Sonntags geht es um die Bedeutung des Sabbat für den Menschen. Im fünften Buch Mose wird der Sabbat mit der Befreiung aus Ägypten begründet; nur freie Menschen können ruhen und Feste feiern:: „Gedenke, dass du Sklave warst in Ägypten und dass dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbat zu begehen.“ (Dtn 5,15) Die frühen Christen fanden in Christus die wahre Sabbatruhe. Er lag an einem Sabbat im Grab. Am nächsten Tag, dem Tag nach dem Sabbat, stand er von den Toten auf. Mit Christus hat eine neue Schöpfung begonnen. Der Sonntag hat daher eine besondere Stellung als Tag des Herrn. Im Markusevangelium sagt Jesus: „Der Menschensohn auch Herr über den Sabbat.“ (Mk2,27) Der Sabbat und der Sonntag erinnern uns daran, dass wir freie Menschen sind; als Erlöste und Befreite dürfen wir leben. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen
Stefan Notz
Dreifaltigkeitssonntag
Jesus sendet die Jünger aus: „Geht und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geites.“ (Mt28) Am Sonntag nach Pfingsten ehrt die Kirche die Heiligste Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Geist. Gott ist in menschlichen Begriffen nicht zu fassen. „Wenn du es begriffen hast, ist es nicht Gott“, sagt der Hl. Augustinus. Und doch macht Gott sich selbst für uns verstehbar. Er offenbart sich als Schöpfer der Welt und in der Geschichte des Volkes Israel und endgültig in Jesus, dem Christus. Der Heilige Geist heiligt die Welt durch seine Gegenwart. In diesem Geist sollen Christi Jüngerinnen und Jünger den Menschen die Liebe und Güte Gottes vermitteln und den Glauben an den dreieinen Gott vertiefen. Der Glaube braucht Beziehung, nämlich die Beziehung zu Gott. Wie auch Gott nicht einsam ist, sondern innerhalb der göttlichen Dreifaltigkeit ganz Liebe und Gespräch ist, so braucht unser Glaube das Gespräch mit Gott im Gebet, das Hören auf sein Wort, den Empfang der Sakramente und den geschwisterlichen Austausch des Glaubens. Alles steht und fällt mit der Zusage unseres Herrn: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“
Stefan Notz
Pfingsten
Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Pfingsten ist ein Ereignis. Da ist viel Energie - die Apostelgeschichte sagt das im Bild der Feuerzungen. Pfingsten bewegt. Die Jüngerinnen und Jünger verlassen das Haus, gewinnen neuen Mut und gehen unter die Menschen. Der Geist von Pfingsten will auch uns „leiten“ und „führen“. Die Wahrheit Christi dürfen wir nicht nur glauben, sondern sollen sie tun. Der Apostel Paulus spricht von den Früchten des Geistes, zum Beispiel Milde, Freundlichkeit und Geduld. Das sind nicht nur Charakteranlagen. Früchte des Geistes haben eine tiefere Quelle: Gottes heiligen Geist. In der Kraft des Geistes Gottes kann es gelingen, allen Geschöpfen Menschenwürde und Respekt entgegen zu bringen. Gott „gießt seinen Heiligen Geist aus in unsere Herzen“. Es ist dieser geistreiche Gott, der uns zu inspirierten Geschöpfen macht. Die geistliche Überlieferung kennt die sieben Gaben des Heiligen Geistes: Weisheit und Verstand, Rat und Stärke, Wissenschaft, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Dem Gott, der diese Gaben gibt, möchte ich vertrauen. Ich wünsche uns allen die Gaben des Heiligen Geistes.
Stefan Notz
7. Sonntag der Osterzeit
„Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt“, so steht es in der lukanischen Apostelgeschichte (Apg2, 4). Es ist Gottes Geist, der Leben schafft und allem Lebendigkeit verleiht. Ich stelle mir einen Menschen vor, der bei strenger Sonnenhitze durch die Wüste irrt. Alles um ihn herum und auch er selbst ist ausgetrocknet. So geht es mir selbst manchmal auch. So geht es, denke ich, vielen Menschen. Sie sind körperlich oder seelisch ausgelaugt. Es fehlt ihnen an Saft und Kraft. In einer Phase innerer Trockenheit kommt man leicht in die Versuchung aus jeder „Pfütze“ zu trinken. Dann nimmt man alles mit, was sich an Ablenkung bietet. Die Bibel spricht vom Geist Gottes im Bild vom lebensnotwendigen Wasser. Der Geist Gottes verwandelt die „Wüste“ in einen bewässerten, fruchtbaren Garten. Er schenkt das nötige Wachstumsklima. Ohne diesen Lebensspender kann nichts wachsen und gedeihen. Unsere Kirche durchlebt in der Gegenwart eine Zeit geistlicher Dürre. Sie braucht eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie braucht die Erfahrung des Pfingstfestes. Ich wünsche uns die belebende Kraft von Gottes Heiligem Geist. Frohe Pfingsten.
Stefan Notz
6. Sonntag der Osterzeit
„Bleibt in meiner Liebe!“ (Joh 15,9) Das Evangelium vor Christi Himmelfahrt hat den Charakter eines Testamentes: die Worte Jesu sollen in den Herzen seiner Freundinnen und Freunde lebendig bleiben, also auch nach seiner Himmelfahrt. Jesu Liebe bleibt, wenn die Jüngerinnen und Jünger, also auch wir, in seiner Liebe bleiben. Jesus hat uns nicht nur etwas von der Liebe Gottes gezeigt oder mitgegeben; er hat alles gegeben. Der Theologe Hans Urs von Balthasar schreibt dazu: „Christus hat den ganzen Abgrund der Liebe Gottes mitgeteilt und uns erwählt, darin zu leben; was ist selbstverständlicher, als dass wir dieses Alles – ausser welchem es nur das Nichts gäbe – uns genügen lassen? Ja, dieses mitgeteilte Alles ist etwas, um was wir den Vater immer neu bitten dürfen. Sind wir bei Christus, dann wird uns der Vater alles geben.“ Das Evangelium blickt, so verstehe ich es, schon auf Pfingsten voraus: die Gabe ist Gottes Heiliger Geist, der in uns die Aufgabe zu lieben erfüllen hilft. Ein Gebet von Sr. Nadya Ruzhina, OSB, lautet: „Oh, Geist Gottes in mir, lehre mich dich immer mehr lieben, so dass ich meinem Herrn und Gott Jesus Christus nachfolgen und im Alltag auf seinen Spuren bleiben kann. Lehre mich, tiefer im Glauben zu wachsen und das zu werden, was du von jeher gewünscht hast. Heiliger Geist lebe in mir. AMEN.“ Ich wünsche uns den Heiligen Geist Gottes, damit wir bleiben: Er in uns und wir in ihm.
Stefan Notz
5. Sonntag der Osterzeit
Das Sonntagsevangelium vom 5. Sonntag in der österlichen Zeit (Joh 15,1-8) stellt Jesus im Bild des Weinstocks vor. „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. (…) Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.“ Getrennt von Jesus sein, das bedeutet: Ohne Gottvertrauen mit Gott und der Welt und sich selbst zurechtkommen wollen. Was würde das heißen? Ohne Gottvertrauen leben bedeutet: misstrauisch sein müssen, voller Angst, zu kurz zu kommen und immer in Angst um den eigenen Anteil an allem gebracht zu werden. Ohne Güte leben heißt: alles, was ich gut meine und auch gut mache, wird als selbstverständlich und ohne ein Wort des Dankes hingenommen. Darum ist keine Übertreibung des Evangeliums, wenn Jesus sagt: Wer nicht in mir bleibt – also: wer ohne Gottvertrauen und Güte lebt, der wird wie eine unfruchtbare Rebe weggeworfen, und er verdorrt. Die Trennung von Jesus ist für den, der Jesus als maßgeblich für das Menschlichsein erkannt hat, nicht vorstellbar. Dass uns das nicht geschieht, dazu sind wir Kirche: Durch unser gemeinsames Hören, Beten und Feiern und auch durch unser Glaubenszeugnis füreinander vertiefen und festigen wir die Verbundenheit mit Jesus Christus. Und umgekehrt: Durch diese Verbundenheit mit ihm sind wir Kirche. Mehr braucht es dazu nicht. Aber das braucht es unbedingt.
Stefan Notz
4. Sonntag der Osterzeit
„weiter – höher – schneller“, diese Lebenseinstellung funktioniert schon lange nicht mehr, das zeigt sich in vielen Bereichen des Lebens und der Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit mit vielen Veränderungen, und oft wissen wir noch nicht wirklich, wo es hingehen soll mit Blick auf unsere Lebensfragen, mit Blick auf die Schöpfung oder in unserer Kirche. Weiterleben wie bisher? Oder weiterleben und etwas Neues wagen? Es kann sein, dass es wichtig ist, etwas anders zu machen als bisher – um des Lebens willen. Weiterleben bedeutet für mich der Hoffnung Raum zu geben, also nicht alles zu eng sehen. Das Evangelium bedeutet schließlich Weite und schenkt Luft zum Atmen. Ich kann darauf achten, wo mehr Leben, mehr Freude und mehr Freiheit wachsen. Dazu ist für mich Jesus Christus der Weg. Er wird am 4. Sonntag der Osterzeit vorgestellt als der Gute Hirte, der sein Leben für die Seinen gibt. An der Seite des guten Hirten ist eben genau das möglich: weiterleben. Nicht im Sinne einer fortgesetzten Ausbeutung des Lebens nach dem Motto „Schneller, höher und weiter“, sondern im Sinne des Evangeliums: Er, der gute Hirte, schenkt uns sein Leben. Wir dürfen es annehmen und verantwortlich gestalten für die Schöpfung, für Menschen und in den Fragen unserer Zeit. So werden aus Jüngerinnen und Jüngern Jesu auch gute Hirtinnen und Hirten im Heute.
Stefan Notz
3. Sonntag der Osterzeit
Die Zeugen der Auferstehung zweifeln. Sie halten den Auferstandenen für eine Art Gespenst. So berichtet es der Evangelist Lukas (24,37ff.). In einer italienischen Übersetzung steht dafür das Wort „fantasma“. Doch die Jünger phantasieren nicht. Der Auferstandene ist der Gekreuzigte. „Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht“, entgegnet Jesus den Jüngern und zeigt ihnen seine Hände und seine Füße. Bei Joseph Ratzinger (später Papst Benedikt XVI.) lese ich: „Ein Glaube, der nicht Fleisch und Knochen hat, ist bloß intellektuell oder geistlich oder gefühlsmäßig. Er wäre keine Antwort auf die Gegenwart Jesu; Glaube wäre dann nur ein Ornament für einige schöne Anlässe, für den einen oder anderen Sonntag, für die Hochzeit, für die Taufe usw.. Der Auferstandene aber hat Fleisch und Knochen, und deshalb muss unser Glaube jeden Tag Fleisch werden, d.h. eintreten in unsere sozialen Beziehungen, in unsere Arbeit. Glaube muss mit Fleisch und Knochen Wirklichkeit werden.“ Ich wünsche, dass der Glaube für uns immer neu Hand und Fuß bekommt.
Stefan Notz
2. Sonntag der Osterzeit
„Friede sei mit euch!“ (Joh 20,19) Mit diesen Worten tritt Jesus, der Auferstandene, in die Mitte seiner Jünger. Jesus kommt, so berichtet es Johannes, als die Türen verschlossen waren. Das Evangelium spricht in Bildern und will sagen: Du kannst noch so entmutigt, so eingesperrt, so schuldig, so ohnmächtig sein, wie du willst – wenn Gott wirklich Gott ist, ist das für ihn kein Hindernis. Das hat Jesus durch sein Leiden und Sterben sichtbar gemacht. Die Jünger waren damals entmutigt, nach Jesus gekreuzigt worden war. Das erste Wort des Auferstandenen lautet: Friede sei mit euch. Übersetzt in die Sprache von heute heißt das: Habt keine Angst! Vom Apostel Thomas wird gesagt, er war nicht dabei als Jesus kam. Ihm sagt Jesus das Wort: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist genau unsere Situation im Glauben. Auch unser Glaube kann sich auf keine Erscheinungen stützen. Unser Glaube gründet sich – wie bei Thomas – auf dem Leben und Sterben Jesu. Im Klartext: Wer lebt, wie Jesus lebte; wer tut und sagt, was er tat und sagte; wer schließlich stirbt, wie er starb – von dem darf man überzeugt sein, dass er mit allem, was zu seinem Leben gehörte, nicht verloren geht, sondern auf immer in Gottes Hand gerettet sein und bleiben wird. Jesu Leben und Sterben ist das eigentlich glaubwürdige Zeichen seiner Auferstehung. Ostern ist keine Idee, sondern eine Erfahrung. Die Erfahrung machen und weitergeben werden wir, wenn wir uns an das halten, was der Auferstandene dem kritischen Thomas rät: nicht sehen und doch glauben.
Stefan Notz
Ostersonntag
Am Ostermorgen, so berichtet es das Markusevangelium (Mk16,1-7) finden die Frauen das Grab Jesu offen. Der Stein ist weggewälzt. Ein Engel sagt Ihnen: “Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier.” Das ist die Osterbotschaft, die uns verkündet wird. In der Hl. Osternacht erneuern wir unser Taufbekenntnis und werden mit dem neuen Taufwasser besprengt. Das Wasser der Taufe sagt mir: Gottes Kraft, das Leben selbst, durchdringt uns. Daraus gewinne ich Kraft zum Leben. Ich darf der Osterbotschaft trauen. Gott schenkt ein neues Beginnen inmitten einer Welt von Leid und Tod. Ich darf dem Leben trauen und muss dabei den Tod nicht verdrängen. Ostern sagt mir: ich muss dem Tod nicht davonlaufen. Ich würde dann den Sinn für das Leben verlieren. Jesus ist dem Tod nicht aus dem Weg gegangen. Er hat ihn kommen sehen. Der Karfreitag ist daher keine menschliche Panne , sondern Menschlichkeit bis zum Äußersten. Im Blick auf den gekreuzigten Jesus begreife ich, was Ostern ist: Leiden und Tod nicht einfach hinzunehmen- und schon gar nicht zu verdrängen, sondern anzunehmen und mitzutragen. Darin liegt Hoffnung für die Erde und die Menschen, die auf ihr leben. Weil Christus lebt - füreinander aufstehen. Wo das zu spüren ist, da wird Ostern.
Stefan Notz
Palmsonntag
Jesus zieht in Jerusalem ein. So berichtet es das Markusevangelium am Palmsonntag. Mit Zweigen in den Händen rufen die Menschen freudig „Hosianna – gelobt sei Jesus, der im Namen Gottes kommt“. Die Freude dauert nicht lange. Die Begeisterung über Jesus schlägt um in das „Kreuzige ihn!“. Ich sehe Jesus auf dem Esel in Jerusalem einziehen. Mir wird klar: Jesus ist nicht der stahlgehärtete Siegertyp, der unberührt an den Leidensgeschichten der Menschen vorbeigeht oder über sie weg. Er ist kein Held wie Siegfried von Xanten. Er geht die dunklen Wege menschlicher Ohnmacht mit bis zum toten Punkt. Er verzichtet im Ölgarten auf das Schwert. Er geht freiwillig in ein Gerichtsverfahren, das ihm keine Chance lässt. Er lässt sich lieber niederschlagen und aufs Kreuz legen, als dass er andere niederschlägt. Jesus geht diesen Weg konsequent für uns. Ich beginne zu verstehen, dass Gott nicht allmächtig genannt wird, weil er vordergründig alles kann, was er will, sondern weil er auch noch die Macht der Vergeltung durch die Macht der Liebe verwandeln kann. Solche verwandelnde Liebe ist die größere Macht. Martin Luther King hat das schon richtig verstanden: »Macht mit mir, was ihr wollt, ich werde euch dennoch lieben.“ Ihnen allen wünsche ich gesegnete Kartage.
Stefan Notz
5. Fastensonntag
Von Erhöhung spricht das Evangelium des Sonntags. Christus wird erhöht am Kreuz. “Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen.“ (Joh12,32) Der Evangelist Johannes greift damit ein alttestamentliches Wort auf, das mit neuem Sinn gefüllt wird. Erhöhung drückte bis dahin die Einsetzung in die Königswürde aus. Johannes setzt „Erhöhung“ ein für den Vorgang der Kreuzigung, bei dem Christus über die Erde „erhöht“ wird. Für das Johannesevangelium fallen der Karfreitag, Ostern und Christi Himmelfahrt ineinander. Das Kreuz erscheint als Königsthron, von dem aus Christus regiert und die Menschen mit weit geöffneten Armen an sich zieht. Bei Joseph Ratzinger (später Papst Benedikt XVI.) lese ich. „Christus am Kreuz ist das Gegenbild zu Adam, dem ersten Menschen, der in eigenmächtiger Anmaßung sich selbst erhöhen, sich selbst vergotten wollte und darüber sich selbst zerstörte und verlor. Die Erhöhung Christi ist Ausdruck für das Gesetz des Weizenkorns: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein; stirbt es aber, so bringt es viele Frucht (Joh 12,24).“ An diesem Sonntag werden in den Kirchen üblicherweise die Kreuze verhüllt. Was das Kreuz bedeutet wird sichtbar erst nach Ostern, wenn der Gekreuzigte sich zeigt als der Auferstandene. Ich wünsche allen ein gutes Zugehen auf die österlichen Tage.
Stefan Notz
4. Fastensonntag
Das Evangelium vom vierten Sonntag in der vorösterlichen Zeit spricht vom göttlichen Gericht. Das ist eine Vorstellung, die von vielen Menschen mit Skepsis betrachtet wird. Das „Gericht“ ist aber Bestandteil der Frohen Botschaft. Der Abschnitt aus dem Johannesevangelium (Kap.3,18ff) lässt mich die Rede vom Gericht neu anschauen. Die entscheidende Aussage ist, dass wer die Liebe Gottes zurückweist, sich selber richtet. Gott hat keinerlei Interesse, den Menschen zu richten; er ist lauter Liebe, die soweit geht, dass „Gott seinen Sohn für uns hingibt“. Mehr kann Gott uns Menschen gar nicht geben. Die Frage ist, ob ich diese Liebe annehme, so dass sie wirksam und fruchtbar sein kann. Im Bild von Licht und Finsternis bringt der Evangelist dies ins Bild: die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Gericht hat also zu tun mit unserer Freiheit und der Haltung zu Gottes Liebe und seiner Geistkraft. Nehme ich seine Liebe an oder verweigere ich mich. In der neutestamentlichen Lesung unterstreicht Paulus das als Theologe: „Gott (…) hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe (…) zusammen mit Christus lebendig gemacht.“ Gott will retten, nicht richten. Das ist die Frohe Botschaft an diesem Sonntag, der in der Überlieferung LAETARE genannt wird: Freue dich. Ich wünsche mir und uns, dass diese Freude unser Leben durchdringen kann.
Stefan Notz
3. Fastensonntag
Tempelreinigung. Jesus räumt im Evangelium gründlich auf. Diese Seite kennen wir bei Jesus eigentlich nicht. Aber sein Tun ist nur mit einer tiefen Liebe zum Tempel zu erklären. Der Tempel war für Jesus der Ort, Gott zu begegnen, zu Gott zu beten, mit ihm zu sprechen. So hat sich in der tiefen Liebe von Jesus zum Tempel seine tiefe Liebe zu Gott gezeigt. Der Tempel war nicht irgendein Ort. Der Tempel war der heilige Ort. Klar: beten kann man auch außerhalb bestimmter Orte. Jesus hat oft einsame Orte aufgesucht, wenn er beten wollte. Die Händler hatten den Tempel zu einer Markthalle gemacht. Nicht, dass hier keine Gottesdienste stattgefunden hätten. Doch was Jesus sah, das hatte ihn wütend gemacht. Offensichtlich hatte der Handel Überhand genommen. Der Tempel war für einige zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden. Das Gebet wurde immer mehr zurückgedrängt. Gott aber darf nicht für wirtschaftliche Interessen missbraucht werden. Damit provoziert Jesus die Händler. Sie sehen ihre Existenz bedroht. Jesus will die Menschen zu Gott zurückführen. Daher braucht es die Reinigung des Tempels. Jede Erneuerung - auch in unserer Zeit - fängt bei mir selbst an. Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Was ist mein Tempel, mein heiliger Ort?
Stefan Notz
2. Fastensonntag
Glaube ist vor allem ein Weg. Abraham war im Glauben unterwegs. Er versuchte den Gott kennenzulernen, an den er glaubte, von dem er aber nur wenig wusste. Abraham ist der Mensch, der Gott sucht; Abraham sind alle Menschen, die Gott suchen; Abraham ist jeder von uns auf seinem Weg zu Gott, jeder, der unterwegs ist, um seinem Wort zu folgen. Die durchaus schwierigen biblischen Texte des 2. Fastensonntags wollen ermutigen im Glauben voranzugehen. Sie möchten das Grundmisstrauen besiegen, dass sich oft in die Gottesbeziehung hineindrängt und auch in die Beziehung zu anderen Menschen und auch in alles, was neu und wahr ist. Abraham war Gott gehorsam und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet (Röm4.3). Isaak bleibt am Leben. So grauenvoll die Erzählung von Abrahams Opfer (Gen 22) auch ist, sie zielt auf Errettung. In Jesus Christus wird die Errettung vom Tod geschenkt. „Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Glaube ist ein Weg. Wir sind eingeladen ihn als Kinder Abrahams zu gehen. Jesus ist Schritt für Schritt in die Gewissheit hineingewachsen, dass es nichts gibt, was ihn dem lebendigen Gott entreißen könnte, nicht einmal das Sterben. Ich möchte in dieser österlichen Hoffnung wachsen und den Glaubensweg gehen.
Stefan Notz
1. Fastensonntag
Die vorösterliche Bußzeit, die Fastenzeit, umfasst 40 Tage. Jesus sagt: „Ich bin gekommen, nicht um meinen Willen zu erfüllen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.“ In Wüste bereitet sich Jesus 40 Tage genau darauf vor: den Willen Gottes zu erfüllen. Die 40 Tage in der Wüste waren für Jesus so etwas wie eine Probezeit. Die Fastenzeit kann ich auch für mich als Probezeit deuten. Wie Jesus seinen Weg und seine Botschaft gefunden hat, so kann ich meinen Weg anschauen und mich fragen, was mich trägt und hält im Leben und im Glauben. Probezeit - Parolizeit! Der Geist hat Jesus in die Wüste geführt, um dem Versucher da, wo er am stärksten war, Paroli zu bieten.
Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium! Die Fastenzeit will eine Zeit der Vorbereitung auf das Osterfest sein. Was ist wirklich wichtig für mich? Worauf kann ich – zumindest auf Zeit - verzichten und die Erfahrung machen, dass es mir gut tut und mir an Lebensqualität nichts fehlt.
Stefan Notz
6. Sonntag im Jahreskreis
Der 11. Februar ist der Welttag der Kranken. Das Evangelium des Sonntags (Mk 1,40-45) zeigt Jesus in einer sehr menschlichen Geste. Er leidet mit Anderen mit. Es sind Aussätzige, also isolierte Kranke, die Jesu Güte und seine göttliche Macht erfahren. Durch eine Berührung beendet Jesus die Isolation. Wir haben heute Isolierstationen in den Krankenhäusern, aber viel häufiger fühlen sich Menschen isoliert, die lange erkrankt sind und am sozialen Leben nicht oder nur eingeschränkt teilnehmen können. Zum Welttag der Kranken schreibt Papst Franziskus: „Die Bestimmung zur Gemeinschaft ist tief im menschlichen Herzen eingeschrieben. Die Erfahrung der Verlassenheit und Einsamkeit trifft Menschen um so mehr in Zeiten der Gebrechlichkeit, Ungewissheit und Unsicherheit.“ Aussätzige werden sie in Bibel genannt. Isolierte, Ausgegrenzte, am Rand der Gemeinschaft stehende und Unbeachtete gibt es heute in großer Zahl. Glaube kann heilen. Hoffnung kann heilen. Liebe kann heilen und befreien. Das Evangelium von Jesus Christus ist für mich die beständige Einladung und Aufforderung dazu. Jesus berührt mit seiner Hand den Kranken. Er wird geheilt. Wem strecke ich heute meine Hand entgegen?
Stefan Notz
5. Sonntag im Jahreskreis
Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass Jesus Kranke heilt. Viele werden aufmerksam und wollen Jesus sehen und hören. Er aber entzieht sich. Er geht an einen einsamen Ort, um zu beten. Er möchte Kraft tanken für seinen Auftrag das Reich Gottes zu predigen. Das Sonntagsevangelium (Mk 1,29-39) stellt neben einer Heilung durch Jesus das Suchen in den Mittelpunkt. Die Jünger machen sich auf die Suche nach Jesus. Als sie ihn endlich finden, berichten sie ihm: „Alle suchen dich.“ Eng verbunden mit dem Geheiltwerden durch Jesus ist das Suchen, die Suche nach Jesus. Das sagt mir das Evangelium dieses Sonntags: ich muss die Nähe Jesu suchen. Das kann in vielfachen Weisen geschehen: zum Beispiel im Lesen der Hl. Schrift, in einem vertrauensvollen Gespräch oder in der Feier der Sakramente. Zum Suchen und Finden lädt das Evangelium mich ein. Am Ende darf ich mich von Gott finden lassen. Diese Frohe Botschaft verkündige ich gerne, auch in dieser Zeit der großen Umbrüche in Kirche und Gesellschaft. Die Frohe Botschaft ist für mich immer wieder motivierend. Der Apostel Paulus ist sich völlig sicher: „Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben.“ (1 Kor 9, 23) Jesus suchen und finden. Viel Motivation für mich am Anfang der neuen Woche.
Stefan Notz
4. Sonntag im Jahreskreis
In der Synagoge in Kafarnaum staunen die Zuhörenden über Jesus. Er lehrt mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten (vgl. Mk1,21-28). Wenn Jesus spricht, ist nicht nur der Inhalt seiner Rede von Bedeutung; er selbst ist das Wort Gottes für uns. Daher die Wirkmacht seiner Rede. Papst Franziskus hat den dritten Sonntag im Januar zum Sonntag des Wortes Gottes erklärt. Er schreibt: „Wir verspüren die dringende Notwendigkeit, uns mit der Heiligen Schrift und dem Auferstandenen eng vertraut zu machen, der nie aufhört, das Wort und das Brot in der Gemeinschaft der Gläubigen zu brechen. Aus diesem Grund müssen wir zu einer ständigen Vertrautheit mit der Heiligen Schrift gelangen, sonst bleibt das Herz kalt und die Augen verschlossen, da wir, wie wir nun einmal sind, von unzähligen Formen der Blindheit betroffen sind.“ Einige praktische Fragen fügt Papst Franziskus hinzu: „Habe ich das Evangelium in meinem Zimmer griffbereit? Lese ich es jeden Tag, um darin den Weg des Lebens wiederzufinden? Habe ich in der Tasche ein kleines Exemplar des Evangeliums, um darin zu lesen? Habe ich wenigstens eines der vier Evangelien vollständig gelesen? Das Evangelium ist ein Buch des Lebens, es ist einfach und kurz, und doch haben viele Gläubige nie eines von Anfang bis Ende gelesen.“ Mich lädt das Evangelium des Sonntags ein das Wort Gottes zu hören. Ich kann es täglich wie einen Schlüssel in der Tasche tragen, wie einen Schlüssel zu mir selbst.
Stefan Notz
3. Sonntag im Jahreskreis
Jesus beruft Simon und Andreas, Jakobus und Johannes in seinen Jüngerkreis. So berichtet es das Markusevangelium (vgl. Mk1,16ff). Die vier sind erfahrene Fischer. Fische fangen ist ihr Handwerk. Viel Erfahrung bringen sie mit. Von nun an sollen sie Menschenfischer werden. Die Fischer werden aus ihrer weltlichen Tätigkeit herausgerufen – und sie folgen ohne Zögern dem Ruf Jesu. Der Theologe Hans Urs von Balthasar spricht von „exemplarischen Berufungen“ und will damit sagen, dass es hier nicht um Ausnahmen geht. Auch Christinnen und Christen, die in ihren weltlichen Berufen tätig sind, werden von Jesus Christus in den Dienst des Reiches Gottes gerufen. Das geschieht zum Beispiel wo Menschen sich anderen zuwenden. Der vormalige Bischof Wanke von Erfurt bringt das auf den Punkt in sieben kurzen Sätze: Ich höre dir zu. Ich gehe ein Stück mit dir. Ich rede gut über dich. Ich bete für dich. Ich teile mit dir. Ich besuche dich. Du gehörst dazu. – Danke für viele Menschen-fischerinnen und Menschenfischer unter uns!
Stefan Notz
2. Sonntag im Jahreskreis
Mit Beginn dieses Jahres hat in unserem Bistum die Bildung Pastoraler Räume begonnen. Die Zusammenarbeit von selbständigen Pfarreien sowie der haupt- und ehrenamtlich Seelsorgenden und Mitarbeitenden soll die Verkündigung der Frohen Botschaft unter in Zukunft deutlich veränderten Rahmenbedingungen weiter ermöglichen. Ein richtiges Anliegen, finde ich, aber wieder einmal sind es Strukturfragen, die sich in der Kirche in den Vordergrund drängen. Die Gründe sind offensichtlich: es gibt weniger Menschen, die einen kirchlichen Beruf wählen, weniger Menschen, die ihren Glauben in einer kirchlich gebundenen Weise leben und die Zahl der Katholiken nimmt ab. Strukturfragen sind wichtig, aber sie helfen den Menschen weder bei der Beantwortung der Lebensfragen, noch beantworten sie eine spirituelle Sehnsucht. Mir hilft das Evangelium des Sonntags. Andreas und ein anderen Jünger möchten Jesus kennenlernen. Sie suchen die persönliche Begegnung und fragen „wo wohnst Du?“. Diese Frage meint: Wer bist du? Und Jesus antwortet: „Kommt und seht!“ (Joh 1,39) Jesus sagt nicht: Glaubt! Hört! Bekehrt euch!, sondern einfach „Kommt und seht!“ Nähe ist entscheidend. Daran hängt es auch in einem Pastoralen Raum. Ohne persönliche Nähe zu Jesus Christus hilft auch kein Pastoraler Raum.
Stefan Notz
Taufe des Herrn
Als Jesus von Johannes im Jordan getauft wird, spricht die Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn. (vgl. Mk1, 11) Jesus stellt sich in die Reihe der Sünder und empfängt die Bußtaufe des Johannes. Dabei kommt der Heilige Geist auf Jesus. Es ist der Geist, der Jesus in die Wüste führen wird zur Vorbereitung und Stärkung seiner Sendung. In der Kraft des Heiligen Geistes verschenkt Jesus sein Leben an uns. Zuerst in Galiläa, dann in Jerusalem und schließlich auf Golgotha. Wir haben die christliche Taufe empfangen. Diese wird in den biblischen Texten auch mit dem Wort Wiedergeburt bezeichnet. Noch einmal von vorne beginnen, den ganzen alten Ballast hinter sich lassen, sich wie neu geboren fühlen. Das geschieht in der Heiligen Taufe. Nur bedenken wir es kaum und erfahren es kaum noch. Am Anfang des Christenlebens steht die Taufe aus dem Wasser und dem Heiligen Geist. Der Geist Jesu eröffnet uns einen neuen, ungeahnten Lebensraum, er eröffnet uns Gott. Neu anfangen in der Kraft Gottes, seines Heiligen Geistes. Wenn wir selbst entdecken, dass die Taufe uns eine einzigartige Chance schenkt, wie neu geboren zu leben, wird dieses Tor der Taufe für andere wieder auffindbar und lädt zum Eintreten ein. Wir dürfen uns unserer Taufwürde neu bewusst werden. Wir sind seine geliebten Töchter und Söhne. Ich wünsche Ihnen und Euch dieses Selbstbewusstsein aus der Taufe.
Stefan Notz
2. Adventssonntag
„Tröstet, tröstet mein Volk“ (Jes 40,1). Gott gibt dem Propheten Jesaja den Auftrag die Menschen in der Not zu trösten. Die Katastrophe war eingetreten: Jerusalem erobert, der Tempel zerstört, ein maßgeblicher Teil der Bevölkerung ins Babylonische Exil deportiert. Und dann folgt jahrzehntelanges Schweigen. „Tröstet mein Volk“. Die Wirkung dieser Worte entfaltet sich erst so richtig, wenn die Stille davor mitgedacht wird. Eine lange, drückende Stille. Die Stille des Exils. Gott schweigt. Ich meine: wir kennen diese Not des Glaubens sehr gut. Gott scheint sich zurückgezogen zu haben aus der Welt, aus der Kirche. Vieles liegt am Boden und doch bleibt etwas für die Ewigkeit: das Wort Gottes. Die Krise und das erfahrene Leid werden nicht schöngeredet, aber es gibt Hoffnung und Grund zur Freude: Gott ist da. Er sorgt behutsam für Menschen, die die Hoffnung verloren haben. Er trägt sein Volk wie ein Hirte das Lamm an seiner Brust. Johannes der Täufer kündet diesen Gott an. „Bereitet den Weg des Herrn!“ (Mk 1, 3) Möge sich diese Hoffnung bewähren. Das wünsche ich mir und uns allen.
Stefan Notz
1. Adventssonntag
Die Zeit des Advent ist für viele eine Zeit des schönen Brauchtums mit Kerzenschein und Kindheitserinnerungen. Dem gegenüber steht die Perspektive des Glaubens. Gott kommt zur Welt. Es gilt ihn zu erwarten. „Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen“ (vgl. Mk13,36). Gottes Ankunft vorbereiten, dazu lädt die Liturgie der Kirche in den Wochen vor Weihnachten ein. Ein Adventslied hat den Titel: Der kommende Gott. Es stammt von Jochen Rieß. Ich gebe es Ihnen gerne weiter: „Der kommende Gott wird größer sein als du und ich ihn gedacht. Der kommende Gott wird größer sein als wir ihn zurechtgemacht. Der kommende Gott wird größer sein und lebendig, nicht tot und verstaubt. Der kommende Gott wird größer sein als die Kirche ihn je geglaubt. Der kommende Gott schließt uns alle ein, ob Jude, ob Moslem, ob Christ, der kommende Gott ist nicht mein oder dein und er fragt nicht was du wohl bist. Der kommende Gott ist für alle da, ein Gott für die ganze Welt, denn der kommende Gott ist dem Menschen nah, der sich fragt, wer die Welt erhält. Denn der kommende Gott war schon immer der Gott, der uns alle, uns alle, vereint.“ Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit.
Stefan Notz
Christkönigssonntag
Christkönig Halleluja. Am letzten Sonntag des Kirchenjahres wird die Frage gestellt: was hast du in deinem Leben für die Schwestern und Brüder getan, besonders für die Geringsten (Mt 25,40)? Es wird nicht gefragt werden: Was hast du verdient? Welches Land hast du bereist oder wie hoch bist du auf der Karriereleiter gekommen? Die Frage lautet: „Was hast du für die Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan?" Das ist die Frage des gerechten Richters, der uns mit ihr zu verstehen gibt, dass das Stiften von Frieden und der Einsatz für Gerechtigkeit nie voneinander getrennt werden können.
Solang es Fremde, Hungrige, Nackte, Kranke gibt; Gefangene, Flüchtlinge und Sklaven; Menschen mit körperlichen, geistigen oder emotionalen Behinderungen; Menschen ohne Arbeit, Obdach oder ein Stück Land - so lange bleibt die entscheidende Frage vom Gerichtsthron her im Raum: "Was hast du für die Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan?" Diese Frage lässt das Kommen Christi zu einem immer gegenwärtigen Ereignis werden.
Stefan Notz
33. Sonntag im Jahreskreis
Bei Martin Buber, dem berühmten österreichisch -jüdischen Religionsphilosophen (gest. 1965) lese ich : Wer fragt: "Was hat man zu tun?" – für den gibt es keine Antwort. "Man" hat nichts zu tun. "Man" kann sich nicht helfen, mit "Man" ist nichts mehr anzufangen. Mit "Man" geht es zu Ende. Wer aber die Frage stellt: "Was habe ich zu tun?" – den nehmen die Gefährten bei der Hand, die er nicht kannte und die ihm alsbald vertraut werden und antworten: Du sollst dich nicht vorenthalten." Ich denke, dass die Heilige Elisabeth von Thüringen, deren Gedenktag am 19. November begangen wird, eine Frau war, die sich diese Frage gestellt hat: Was habe ich zu tun? Sie wurde nur 24 Jahre alt, prägte aber durch ihre barmherzige Religiosität die folgenden Jahrhunderte. Die Heilige Elisabeth ist die Heilige der christlichen Caritas. Sie gehört für mich zu denen, denen Jesus im Evangelium zuspricht: „Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn“.
Stefan Notz
32. Sonntag im Jahreskreis
Das Evangelium des Sonntags (Mt25,1-13) mahnt zur Wachsamkeit. Ich beziehe die „Wachsamkeit“ auf die Aktualität unserer Gegenwart: Vor 85 Jahren wurden in der Reichspogromnacht die Synagogen zerstört. Heute erfahren die Jüdinnen und Juden in Deutschland wiederum Anfeindungen. Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, betont in einem gemeinsamen Schreiben der NRW- Bischöfe vom 8.11.2023: „Als katholische Kirche stehen wir an der Seite der Jüdinnen und Juden. Wir müssen alles dafür tun, dass jüdisches Leben sicher bleibt – in Deutschland, in Israel und überall. (…) Die Zeit des „NIE WIEDER“ ist jetzt. Die Katholische Kirche hat schon einmal den Fehler gemacht, stillschweigend daneben zu stehen, während jüdische Nachbarn der Hass und die Gewalt einer ideologisierten Menge entgegenschlug. Wir empfinden tiefe Scham über das damalige Schweigen und die Mitwirkung von Christinnen und Christen an den Gräueltaten. Wir stehen im Blick auf Gaza und Israel an der Seite der Trauernden und beklagen die vielen Opfer des Überfalls auf Israel und die vielen Menschen, die in der Folge auf beiden Seiten der Grenze ihr Leben verloren haben. Wir fühlen mit den Menschen, die unfassbares Leid und große existentielle Ängste erfahren.“
Stefan Notz
31. Sonntag im Jahreskreis
Das Evangelium des Sonntags (Mt23,1-12) ist der Beginn einer mahnenden Rede Jesu vor der Passion im Matthäusevangelium. Sie richtet sich an die verantwortlichen Theologen, die anderen sagen, was sie zu tun haben, und es selbst daran mangeln lassen. Reden und Tun müssen aber zueinander passen. Deshalb ist das Evangelium für mich ein kritischer Spiegel. Jesus mahnt, die Herrschsucht abzulegen: Keiner bei euch soll sich Vater oder Meister nennen. Einer ist euer Vater, der im Himmel. Einer ist euer Meister, Christus. Ihr untereinander seid alle Geschwister. Der junge Theologieprofessor J. Ratzinger macht schon 1964 eine weise Bemerkung zum Stichwort „Rabbi“ (Lehrer): „Die Schüler der Rabbinen hofften, einmal Lehrer zu werden und sich über die Menge zu erheben und achtungsvoll mit dem Titel Rabbi ausgezeichnet zu werden; in der Schule des Lehrers Jesus aber hört man nie auf zu lernen“. Jeden Tag neu in die Schule Jesus gehen. So verstehe ich unseren Bischof Dr. Felix Genn, der zum Abschluss der Weltsynode in Rom sagt: „Im aufeinander hören und in den Worten und Zeugnissen der anderen, konnten wir (geschwisterlich) nachspüren, was der Hl. Geist seiner Kirche im 21. Jahrhundert sagen will.“
Stefan Notz
30. Sonntag im Jahreskreis
„Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst“. Das ist Jesu Antwort auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot. So überliefert es der Evangelist Matthäus (vgl. Mt 22, 37-39) Und doch ist die Liebe so oft Mangelware. Bedenken wir nur, wie viele Menschen sich im Leben schwer tun, weil sie wenig Liebe erfahren haben. Wie viel missglückte und zerbrochene Liebe verbirgt sich in so manchem Menschenschicksal. Andere haben Scheu, sich dem Risiko der Liebe auszuliefern. In der Begegnung mit Menschen, die sich als nichtgläubig bezeichnen, geht mir immer wieder auf, dass selbst da, wo uns der Glaube/ Unglaube trennt, die Liebe noch immer verbinden kann. Die gelebte Liebe sagt am Ende das Entscheidende über die Qualität oder den „Ertrag“ unseres Lebens aus. "Gott ist die Liebe" (1 Joh 4, 16). Liebe ist sein Wesen - und nach seinem Bild und Gleichnis sind wir gemacht! Teresa von Avila meinte einmal: "Als Gott den Menschen aus Erde formte, knetete er Liebe in ihn hinein." Die neue Woche gibt mir die Möglichkeit Gott und den Menschen zurückzugeben, was er in mich hineingeknetet hat.
Stefan Notz
29. Sonntag im Jahreskreis
Es geht um`s Geld. So war es schon immer. Auch zur Zeit Jesu war das Geld mit Macht und Ansehen verbunden. Nach dem Evangelisten Matthäus (22,19) lässt sich Jesus von den Pharisäern eine Münze zeigen. Der Kopf des Kaisers ist darauf zu sehen. „Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört“, sagt Jesus, und „gebt Gott, was Gott gehört!“ In den antiken Großreichen waren Münzen weit verbreitet. In Persien, in Griechenland oder im Römischen Reich waren Münzen gewissermaßen die ersten Massenmedien. Sie brachten politische und auch religiöse Botschaften in alle Ecken der jeweiligen Herrschaft. Die Macht war dabei immer verbunden mit Gottheiten, also Politik und Religion waren nicht zu trennen. Wer hat mehr Anspruch, Gott oder der Kaiser? Die Steuer dem Kaiser zu geben ist erlaubt. Wichtiger und entscheidender für Jesus ist der Anspruch Gottes. Es geht eben nicht allein ums Geld. Gott soll nicht durch Münzen, sondern durch Menschen erfahrbar werden. Für mich als Mensch, als Christ und Priester ein hoher Anspruch.
Stefan Notz
28. Sonntag im Jahreskreis
Wieder hält der Sonntag ein Gleichnis Jesu für uns bereit. Wir sind eingeladen zum Fest des Glaubens. „Geht hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein!“ So steht es bei Matthäus 22,9. Ein wunderbares Bild ist das, was Jesus hier von Gott zeichnet. Wir sind die Eingeladenen zum Festmahl eines Königs, wir sind berufen, teilzuhaben an der unendlichen Freude Gottes. Ich ahne , warum Gott so unendlich viel an uns liegt, warum er diese Auszeichnung, diese noch unsichtbare, aber sich immer deutlicher mitteilende Königswürde des Herzens eines jeden Menschen wollte. So groß denkt Gott von uns, und er möchte, dass sein Saal reich ist und weit ist, randvoll von Glück. Das Gleichnis Jesu ist ein Hoffnungsbild: das Bild einer ewigen Hochzeit des Glücks. Hier im Thronsaal Gottes erfüllt es sich. Der Festsaal füllte sich mit Gästen, heißt es im Gleichnis. Sind wir hochzeitlich gestimmt? Eine provozierende Frage in dieser krisenhaften Zeit, denke ich.
Stefan Notz
27. Sonntag im Jahreskreis
Beim Evangelisten Matthäus heißt es: „Ein Gutsbesitzer legte einen Weinberg an und baute einen Wachturm.“ (Mt21,33) Der Weinberg wird anderen anvertraut. Sie sollen den Weinberg bearbeiten und bewirtschaften. Da sind wir gemeint. Den Weinberg nimmt Jesus als Bild für sich und seine Kirche. Die Liebe Jesu zu seinem "Weinberg" Kirche ist heute, denke ich, nicht kleiner geworden, aber wer in der Kirche fühlt sich noch angesprochen, wenn es darum geht, Steine aufzusammeln, den Boden zu bereiten, Wachturm zu sein? Das Feld, in dem heute zu arbeiten ist, ist sicherlich nicht weniger steinig als der Boden Israels. Aber es werden immer weniger, die sich auf den Weg machen, im Weinberg des Herrn zu arbeiten. Ob es daran liegt, dass wir die Steinmauern um uns herum schon zu hoch aufgeworfen haben, so dass man vor lauter Kirche keinen Jesus mehr sieht? Vielleicht sind wir aber auch zu einem Häufchen elend Klagender geworden, die selbst nur noch Steine sehen? Wie lesen und deuten Sie das Sonntagsevangelium?
26. Sonntag im Jahreskreis
Erntedank – wem könnte ich sonst danken?
Glauben bedeutet für mich Annehmen: das Dasein und das Leben, das Glück und den Schmerz, die Freude und das Leid und die Trauer. Annehmen kann ich alles, weil es geborgen ist in Gott, umfangen von seiner Größe und Gnade. Annehmen heißt nicht immer verstehen und erst recht nicht immer mögen, jedoch meint es ein aushaltendes und ausharrendes, manchmal die Vernunft übersteigendes und von Herzen zustimmendes Ja.
Glauben heißt Danken: dass er uns bis hierher getragen hat, dass wir ihn noch haben, dass es noch geht und weitergeht. Danken für alle Freude und allen Trost. Danke, dass das Leben mehr ist als Leisten oder Besitzen oder Konsumieren. Leben heißt Genießen im Unvollkommenen – arm und selig ist es. Ich kann staunend das große Ganze erahnen, ja feiern. Danke für die Ernte, für die Schöpfung, für das Leben. Erahnend brauche ich Gott, sehnend ahne ich ihn, suchend finde ich ihn nicht und finde ihn doch. Zu wem sollte ich gehen? Wem könnte ich sonst danken?
Stefan Notz
25. Sonntag im Jahreskreis
Ein Ärgernis ist das. Die Arbeiter, die nur eine Stunde gearbeitet haben, erhalten denselben Lohn wie jene, die den ganzen Tag geschuftet haben. Das Gleichnis Jesu empört alle, die sich für gerechte Entlohnung einsetzen. Jesus spricht im Gleichnis vom Reich Gottes. Gott ist gütig. Das Reich Gottes steht offen für Erste und Letzte. Das kann unsere Haltung zu aktuellen Gerechtigkeitsdebatten öffnen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir in Freiheit leben können. Dies sollte uns aber nicht dazu verführen, angesichts weltweiten Elends und Unrechts die Augen zu verschließen und unsere Grenzen für jeden Hilfesuchenden unüberwindlich zu machen. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, sind Teil einer großen Flüchtlingsbewegung, die von Süden nach Norden, von Osten nach Westen treibt. Sie konfrontieren uns mit den Ursachen ihrer Flucht. Es ist zukunftsentscheidend, ob wir uns ihnen zuwenden und helfen, die Situation in ihren Heimatländern zu verbessern.
Jesus ist Grund und Ziel unseres Einsatzes für eine gerechtere Welt. Er lehrt uns, die Realitäten mit den Augen der Opfer zu sehen; er weckt den Hunger und Durst nach »Gerechtigkeit für alle«; er schenkt die Verheißung »eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt« (2 Petr 3,13). Darauf hoffen wir, darum beten wir, daran dürfen und müssen wir mitarbeiten.
Stefan Notz
24. Sonntag im Jahreskreis
Kreuzerhöhung
Charles de Foucauld sagt: „Wie ER werden wir immer das Kreuz haben; Wie ER werden wir immer verfolgt sein; Wie ER werden wir immer dem Schein nach besiegt werden; Wie ER werden wir immer in Wirklichkeit triumphieren. Und zwar im Maß, als wir der Gnade treu sind, als wir Ihn in uns leben; in uns und durch uns handeln lassen.“ Das Fest „Kreuzerhöhung“ erinnert an die Auffindung des „wahren Kreuzes Christi“ durch die Kaiserin Helena im Jahre 326 n. Chr. Neun Jahre später wurde den Gläubigen zum ersten Mal in der Jerusalemer Grabeskirche das Kreuzesholz gezeigt - „erhöht“ und zur Verehrung dargereicht. Ich sehe im Kreuz das Schwere, das Leid, das Dunkle das zum Leben gehört. Ich verschließe mich ihm nicht – mit ausgebreiteten Armen öffne ich mich. Das Kreuz lässt mich einen Gott erahnen, der uns einem neuen Morgen entgegenführt.
Stefan Notz
23. Sonntag im Jahreskreis
„Wenn dein Bruder oder deine Schwester sich gegen dich verfehlt, geh` hin und kläre den Konflikt zwischen euch unter vier Augen.“ (Mt18,15). Im Evangelium des Sonntags fordert Jesus eine schnelle Versöhnung. Für mich ist das oft schwer umzusetzen. Ich neige zum Aufschieben, bin träge oder nachlässig. »Vertrage dich ohne Zögern mit deinem Widersacher, solange du noch mit ihm unterwegs zum Gericht bist.“ Es stellt sich die Frage: Wer ist der Gegner? Ist es ein Mensch, der mit mir einen Rechtsstreit angefangen hat und mich jetzt vor Gericht schleppt? Oder ist es das fordernde Wort Gottes, zu dem ich mich durch mein Urteil über eine andere Person in einen Gegensatz gebracht habe und das mich jetzt vor sein Gericht stellen will? Als Mensch und als Christ habe ich Verantwortung. Worte können verletzen, manchmal unbeabsichtigt. Ich muss umgehen mit meinen Fehlern und den Fehlern anderer. Es gelingt mir manchmal gut. Oftmals nicht. Paulus kommentiert im Römerbrief (13,8): „Bleibt niemand etwas schuldig; nur die Liebe schuldet ihr einander immer.“
Stefan Notz
22. Sonntag im Jahreskreis
Jesus wirft im Matthäusevangelium des Sonntags (Mt16,21-27) dem Petrus vor: „… du hast nicht das im Sinn, was Gott will.“ Wer gibt Auskunft, was Jesus heute will? Viele sind ratlos, weil in der Welt und in der Kirche seit den ersten Zeiten der Christenheit sich so ziemlich alles geändert hat. Die Probleme, die wir heute angehen müssen, sind anders als damals. Wir haben den Konflikt der Generationen, wir suchen nach einem alternativen Lebensstil, wir sehen die unglaubliche Diskrepanz zwischen armen und reichen Ländern, wir denken und leben neue Formen von Familie. Manche Zeitgenossen sind enttäuscht, weil die alten Vorstellungen und Lehrsätze zu unseren Aufgaben und Problemen nicht mehr passen, unbrauchbar geworden sind. Sie kommen sich hilflos und verlassen vor. Was will Jesus heute?
Eines ist für mich deutlich: Jesus beantwortet nicht unmittelbar alle unsere Einzelfragen, er bietet keine Lösungen an wie ein Computer. Aber er schenkt seinen Geist, er vermittelt den entscheidenden Ansatz, um weiter zu kommen. Jesus bietet seine Freundschaft an. Er sucht den Menschen, er sucht dich und mich. In und durch in gewinnen wir Leben.
Stefan Notz
21. Sonntag im Jahreskreis
Zwei Bildworte prägen im Evangelium des Sonntags (Mt16,13ff.) die Antwort Jesu auf das Glaubensbekenntnis von Petrus: das Bildwort vom Felsen und das von den Schlüsseln. Zuerst der Fels: Gott selber wird Fels genannt, z.B. in den Psalmen, das heißt, Er ist das Fundament, auf das man sich unbedingt verlassen kann. „Von Gott kommt mir Hilfe, nur er ist mein Fels“ (Ps62,3) Jesus nennt Petrus den „Fels, auf den er seine Kirche bauen will“. Der Glaube ist verlässlich (felsenfest) allein durch Gott und Christus. Das Fundament baut nicht der Mensch, sondern Gott selbst. Das zweite Bildwort sind die Schlüssel: sie versinnbildlichen Verantwortung. Jesus Christus ist der Schlüssel zum Geheimnis Gottes. Jesus gibt dem Petrus persönlichen Anteil an seiner Vollmacht: „Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein.“. Obwohl Petrus am Karfreitag seinen Herrn verleugnete, hat Jesus seine Berufung nie rückgängig gemacht. Trotz der Schwachheit macht Jesus einen Menschen zum besonderen Zeichen für Gottes Treue zu uns. Einem Petrusnachfolger wie Papst Franziskus, der dieses Menschliche ahnbar macht, fühle ich mich verbunden.
Stefan Notz
20. Sonntag im Jahreskreis
Jesus begegnet im Sonntagsevangelium (Matthäus 15,21-28) einer kanaanäischen Frau. Der Name der Frau ist unbekannt. Dieser Frau verdanken wir, so deute ich es einfach mal, dass wir Christinnen und Christen sein können. Sie ist – wie wir – geborene Heidin; sie entstammt nicht dem Judentum. Ich halte sie für so etwas wie unsere Stammmutter im Glauben. Ohne die kanaanäische Frau hätte es vielleicht keine Christen außerhalb des Judentums gegeben. Ob die junge Kirche sich ohne diese Frau getraut hätte, unter den Heiden Christus zu verkünden? Jesus, dessen Sendung vom Vater „den verlorenen Schafen des Hauses Israel“ gilt, bescheinigt ihr: „Frau, dein Glaube ist groß.“ Ich finde diese Geschichte wunderbar. Nichts an unserer Menschenwelt ist Gott so fremd oder fern, dass es nicht Ausdruck seiner Leidenschaft für uns werden könnte. In Jesus Christus ist das Trennende von Juden und Heiden aufgehoben. Der beharrliche Glaube der Frau zeigt eine Gottesspur, die Menschen und Religionen verbindet. Sie kann im Gespräch der Religionen hilfreich sein. Entdecken wird das, wer nicht zu klein von Gott und nicht zu klein von sich selber denkt.
Stefan Notz
19. Sonntag im Jahreskreis
Wer am Niederrhein mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat immer wieder mit Wind und manchmal auch mit kräftigem Gegenwind zu tun. Bei starken Böhen kann es auch zu Fuß anstrengend sein gegen den Wind zu gehen. Die Jünger Jesu, von denen an diesem Sonntag die Rede ist, geraten mit ihrem Fischerboot in einen heftigen Sturm. Sie drohen unterzugehen und haben Angst. Mitten im Sturm begegnet ihnen Jesus. Aber sie erkennen Jesus nicht. Sie halten ihn für ein Gespenst. Erst als Jesus zu ihnen spricht: „Habt Vertrauen. Ich bin es“, fassen sie langsam neuen Mut. „Komm!“ sagt Jesus zu Petrus. Fast übermütig will Petrus über das Wasser auf Jesus zugehen, beginnt dann aber zu versinken. Jesus ergreift seine Hand. Er ist gerettet. Petrus und die Jünger machen eine wichtige Erfahrung: der Glaube kann Kraft und Halt geben, wenn Angst und Zweifel übermächtig werden wie beim Sturm auf dem See. Ich wünsche Ihnen und mir ein Gottvertrauen, dass Seine Hand uns greift und trägt und hält – jeden Tag, durch unser ganzes Leben und sogar durch den Tod.
Stefan Notz
Verklärung des Herrn
Die Schulferien sind nun vorbei. Für die Schülerinnen, die Schüler und Familien beginnt der Alltag mit all seinen Routinen. Der Wecker klingelt wieder früher, die täglichen Wege zur Schule und zurück werden wieder begangen und viele Gewohnheiten bestimmen den Tagesablauf der Familien. Routine hat viel für sich. Sie gibt Verlässlichkeit und Sicherheit. Routinen erlauben mir, dass ich nicht alles neu denken oder erfinden muss. Durch Routine ist es ja schon eingeübt. Wenn aber Gott ins Spiel kommt, hört die tägliche Routine auf. An zwei Beispiele denke diesbezüglich ich in dieser Woche: Da ist der Selige Karl Leisner, dessen Grab sich in der Krypta unseres Domes befindet. Am 12. August ist sein Sterbetag. Er hat das Evangelium von Jesus Christus in einer Zeit sprechen und gelten lassen, als die damaligen Machthaber sich selbst als Herren der Welt stilisiert hatten. Von diesen Machthabern würde nicht das Heil der Welt kommen - das war Karl Leiser völlig klar. Nicht nur aus der täglichen Routine eines Studierenden wurde Karl Leisner von den Nazis gerissen, sondern man raubte ihm sein Leben . Sechs Jahre wurde er im KZ Dachau gemartert. An diesem Sonntag feiert die Kirche das Fest der Verklärung des Herrn. Die Jünger sind mit Jesus – wie jeden Tag – unterwegs. Aber das vertraute Unterwegssein, die Alltagsroutine im Umgang mit ihrem Herrn Jesus wird unterbrochen durch eine tiefe Erfahrung. Oben auf dem Berg erkennen sie in Jesus Gottes Sohn. Lichtvoll und durchdringend wird die Erfahrung vom Evangelisten geschildert. Mitten im Alltag und inmitten der täglichen Gewohnheiten durchbricht die Erfahrung Gottes jede Routine. Die Jünger können den Moment nicht festhalten, aber sie gewinnen neue Kraft. Jesus sagt Ihnen: Steht auf, habt keine Angst! Karl Leisner konnte seine Angst im Vertrauen auf Gott überwinden. Ich wünsche Ihnen und mir einen Alltag, der routiniert Sicherheit und Verlässlichkeit bietet, aber offen ist für die Erfahrung des lebendigen Gottes in allen Dingen.
Stefan Notz
11. Sonntag im Jahreskreis
Jesus sieht die vielen Menschen. Sie sind müde und erschöpft. Sie fragen nach der Wegrichtung. Der Evangelist Matthäus merkt an: „Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ (Mt 9,36) Wie oft sind wir müde und erschöpft vom Alltag, vom Stress, der über uns hereinbricht oder den wir uns selber machen? Wer Zeiten der Erholung nehmen kann oder sich einen Urlaub leisten kann, ist gut dran. Jesus geht es nicht nur um die Erfrischung an Leib und Seele, sondern um die Freude am Reich Gottes. Die ist in Jesus Christus schon mitten unter uns, aber er sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich den Menschen zuwenden: „Geht und verkündet: das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus!“ Die Mitstreiter Jesu müssen etwas von der Art und Kraft seiner Sendung erhalten. Die Apostel lassen sich von der Art und Kraft Jesu prägen. Sie werden von Jesus ausgesandt, um die Frohe Botschaft von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu verkünden. Im Evangelium des Sonntags heißt es: „Jesus hatte Mitleid“. Unser Gott kann mit uns leiden. Er ist Liebe, die mitgeht bis hinein in Sterben und Tod. Die Apostel haben das bezeugt im Leben und im Tod. Jesus Christus sucht auch heute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.“
Während der kommenden Wochen der Schulferien in NRW schreibe ich keine Geistlichen Gedanken zum Sonntag. Im August nehme ich das Schreiben wieder auf und wünsche Ihnen und Euch eine schöne Sommerzeit.
Stefan Notz
10. Sonntag im Jahreskreis
„Folge mir nach!“ So ruft Jesus Levi, den Zöllner. Levi (Matthäus) stellt keine Nachfrage, er bittet um keine Bedenkzeit. Da ist nur Ruf und Antwort. Und zwar endgültig, da Matthäus die Zwölfergruppe nicht mehr verlässt. Es zeigt sich ein Vertrauen, dass der Apostel Paulus an Abraham rühmt: „Er zweifelte nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, (…) fest überzeugt davon, dass Gott die Macht besitzt zu tun, was er verheißen hat.“ (Röm4,20) Der Ruf Gottes zwingt den Menschen nicht, sondern gibt ihm sowohl die Freiheit wie die Kraft, aus eigenem Antrieb zu folgen. Im Ruf „Folge mir“ liegt ein Klang, der beides enthält: dass hier einer spricht, der mich zu meiner bestmöglichen Entscheidung befähigt und, indem er mich braucht, auch den bestmöglichen Lebensinhalt schenkt. Jesus ruft den Zöllner Matthäus. Er gilt als Sünder. In der Vollmacht Gottes ruft Jesus an seinen Tisch, die Zöllner und Sünder und auch uns. „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.“ (vgl. Mt 9,12) Ich höre im Wort des Evangeliums den Ruf des heilenden Arztes Jesus Christus. Er ruft in seine Tischgemeinschaft, die in der Bibel immer eine religiöse Seite hat: Beziehung von Gemeinschaft untereinander, aber in Gott. Die Mahlgemeinschaft Jesu mit den Sündern ist also Ausdruck des heilenden Erbarmens Gottes, das sich in Jesus, als dem Arzt äußert. Er teilt sich selbst aus als höchstes Heilmittel. Ich wünsche uns allen, das wir es gerne annehmen.
Stefan Notz
Dreifaltigkeitssonntag
An diesem Sonntag schreibe ich, Stefan Notz, keinen eigenen Gedanken auf, sondern gebe Ihnen den Impuls von Pater Binu John OIC weiter, den er mir in dieser Woche zugesandt hat. Binu John und ich haben in Kleve zusammen in der Seelsorge gewirkt. Er ist jetzt in Dülken, St. Cornelius und St. Peter im Bistum Aachen eingesetzt: In Gärtnerkreisen heißt der Juni auch Rosenmonat, da die Rosenblüte im Juni ihren Höhepunkt erreicht. Am 1. Sonntag im Juni feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Es ist das komplizierteste Fest des ganzen Kirchenjahres. Ein Gott in drei Personen, wie kann ich mir das vorstellen? Ich versuche es so: Wir alle kennen Wasser in unterschiedlichen Formen. Es zeigt sich als flüssiges Wasser, als Eis und als Dampf, aber es ist immer das gleiche Material. Gott in drei Personen – bei jedem Kreuzzeichen werden wir daran erinnert, wenn wir sagen „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Der Vater, der Schöpfer der Welt, der seinen Sohn in unsere Welt gesandt hat. Und der Sohn hat gesagt: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ Und er hat versprochen, den Hl. Geist zu senden, dass er bei uns bleibt und in uns ist. Die heiligste Dreifaltigkeit in Liebe in sich, vollkommene Liebe! In Jesus hat der Vater für uns alle sichtbar gezeigt, Gott ist Liebe, die nicht bei sich bleibt, sondern sich selbstlos dieser Welt mitteilt in Jesus Christus durch seinen Geist. Durch den Heiligen Geist ist Gott lebendig in unserer Mitte. Durch ihn ist Gottes Liebe in uns. Ja, er ist der Gott in uns. Wir sind Tempel, Wohnung des Heiligen Geistes. Ist nicht die Rose ein Symbol für Liebe? Lassen wir uns in diesem Rosenmonat immer wieder an die Liebe des dreifaltigen Gottes erinnern.
Pater Binu John, Pfarrei Dülken im Bistum Aachen
Pfingsten
Die Pfingsterzählung aus der Apostelgeschichte (2,1-11) treibt so mancher Lektorin und so manchem Lektor die Schweißperlen auf die Stirn. Es ist eine echte Herausforderung, die dort stehenden Ländernamen alle korrekt auszusprechen: „Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten…“ Manchmal sagen die Pfarrer den Lektoren: „Ach, lassen Sie die Namen doch einfach weg, die kennt ja doch niemand…!“ Das ist leicht gesagt. Doch damit wäre ein ganz wesentlicher Inhalt vom Pfingstfest gestrichen. Damit wäre ein zentraler Aspekt von Kirche ausgeklammert. Von Ihrer Geburtsstunde an spricht die Kirche in vielen unterschiedlichen Sprachen und ist doch eins in demselben Geist. Darum geht es am Pfingstfest. Die vielen Sprachen und Kulturen öffnen einen weiten Horizont. Er führt über die politischen und kulturellen Grenzen hinaus. Der Heilige Geist wirkt in der Vielfalt der Sprachen und er bewirkt die Einheit im Verstehen. Ein pfingstliches Wunder! Die pfingstliche Erkenntnis lautet: Die Fremden sind unsere Freunde, weil sie Freunde Gottes sind! Damit verbietet sich jede nationale Arroganz, jede Überheblichkeit anderen Sprachen und Kulturen gegenüber. Gott schenkt uns durch andere Menschen etwas, was ich nur durch sie erfahren kann. Wie schön wäre es, wenn unsere Kirche sich zeigen und bewähren könnte als eine im Heiligen Geist geeinte Verschiedenheit. Einheit in Vielfalt. Das ist meine Hoffnung für unsere Welt. Das ist mein Pfingstwunsch für Sie und für Euch.
Stefan Notz
7. Sonntag der Osterzeit
Im Evangelium des 7. Sonntags der Osterzeit betet Jesus. Er betet nicht für sich selbst, sondern für uns: „Für sie bitte ich; für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir“. vgl. Joh17,9. Jesus betet um Einheit, die wegnimmt, was trennt. In einer Predigt erzählt Prof. Klaus Müller aus Münster folgende Begebenheit: Im Jahr 1888 starb in Roermond ein Ehepaar, die Frau wenige Monate nach dem Mann. Die beiden waren konfessionsverschieden gewesen, er katholisch, sie evangelisch. Wegen des Streits der Konfessionen war es strikt untersagt, dass beide in einem gemeinsamen Grab bestattet wurden. Aber weil die Verwandten wussten, wie sehr sich die beiden geliebt hatten, ersannen sie einen Ausweg. Der evangelische und der katholische Friedhof lagen direkt nebeneinander und waren nur durch eine Mauer getrennt. So legte man die beiden Gräber mit dem Kopfende unmittelbar an die Trennmauer und zog die Grabsteine so hoch, dass sie die Mauer überragten. Und an der Spitze wurden die beiden verbunden durch einen Marmorstein in der Gestalt zweier Hände, die einander festhielten. Jesus betet für uns, für seine Kirche. Er betet um die Macht der Liebe. Die Liebe ist erfinderisch. Keine Trennung kann ihr widerstehen. Je mehr die Kirche sich auf diese Botschaft besinnt wird sie sein können, wozu es sie überhaupt gibt. Darum beten wir in diesen Tagen.
Stefan Notz
6. Sonntag der Osterzeit
Fünfzig Tage umfasst die österliche Zeit. Mit dem 50. Tag, dem Pfingsttag endet der Osterfestkreis in der Liturgie der Kirche. Der Heilige Geist ist die Gabe Gottes nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi. Der Evangelist Johannes lässt Jesus sagen: Der Heilige Geist wird bei euch und in euch sein – vgl. Joh14,17. Um diesen Geist Gottes beten wir. Er möge in seiner Kirche wehen und wirken. Die Bittprozessionen vor Christi Himmelfahrt eigenen sich für das Gebet um den Heiligen Geist ebenso gut wie das Pfingstgebet, das wir in der Wallfahrtskirche in Marienbaum an neun Abenden, beginnend am 19. Mai halten. Was nach biblischem Zeugnis an Pfingsten geschah (vgl. Apg2, 1- 11), hätte kein Mensch für möglich gehalten. Denn tatsächlich schlossen sich viele Menschen den Jüngern Jesu an. Sie ließen sich ein auf Jesus: Arme und Reiche, Alte und Junge, Geschäftsleute und Bettler, Ausländer und Einheimische. Sie alle spürten – und das kann auch heute geschehen - wie sehr sie verwandelt wurden, weil sie sich von Jesus mehr zu Gott hinziehen ließen. Sie spürten neue Kraft, die in der Pfingstgeschichte im Bild der Feuerzungen beschrieben wird. Sie gewannen Mut Christus zu verkünden und verloren die Angst um sich selber und voreinander. Ich wünsche uns allen, dass die kommenden Feiertage uns tiefer in das Ostergeschehen führen. Ostern und Pfingsten schenken mehr als nur freie Tage. Sie schenken die Freiheit der Kinder Gottes.
Stefan Notz
5. Sonntag der Osterzeit
Der Heilige Augustinus (+430) schreibt in seinen Vorträgen über das Johannesevangelium: “Der Weg ist das, worauf man geht; ist etwa der Weg auch der, wohin man geht?“ Augustinus denkt über das Wort Jesu nach: „Ich bin der Weg“. Dieses Wort aus dem Johannesevangelium (14,6) wird verkündet am 5. Sonntag der Osterzeit: Wege bestimmen unser Leben. Jeden Tag aufs Neue sind wir auf ihnen unterwegs, zur Schule oder zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur Arztpraxis. Wir können sagen, dass unser ganzes Leben einem einzigen Weg gleicht. Er beginnt mit der Geburt und endet am Tag unseres Todes. Wir fragen uns manches Mal, wohin uns der eigene Lebensweg führt? Mit den Jüngern im Evangelium gesprochen: „Wie können wir den Weg kennen?“ Jesus nennt sich selbst „der Weg“. Es ist der Weg zu Gott, seinem Vater. Für mich steckt darin eine Zusage: Immer wenn ich vor Entscheidungen bzw. Weggabelungen stehe und überlege, wie es weitergehen soll, darf ich auf Jesus Christus blicken. Er hat sein Leben bis zuletzt in die Hände seines Vaters gelegt. In diesem Vertrauen kann ich meinen Weg gehen – auch wenn Stress und Belastungen ermüden. „Der Weg ist das, worauf man geht; ist etwa der Weg auch der, wohin man geht?“. Für mich beantworte ich das mit einem klaren Ja. „Herr, zu wem sollten wir gehen. Deine Worte bringen das ewige Leben“ (vgl. Joh 6,69).
Stefan Notz
4. Sonntag der Osterzeit
Wo immer Menschen etwas darzustellen suchen, was ihnen wichtig ist, suchen sie Bilder zu schaffen. Die Christen des Anfangs stellten Jesus in ihren bildlichen Darstellungen nicht vor als Herrscher, Lehrer oder Richter, sondern als Hirten mit einem Schaf auf der Schulter, eines wohl, das sich verlaufen hat, das nun erschöpft ist und das er, der Hirte, nun heimträgt. Anlass, ihren Herrn so darzustellen, gab den frühen Christen das Evangelium. Im Evangelium des Johannes lese ich: dem guten Hirten folgen die Schafe, denn sie kennen seine Stimme. Jesus Christus ist der Hirt, der sein Leben für die Seinen gibt. Er hat sich nicht geschont, das, was er uns von Gott auszurichten hatte, in sein eigenes Fleisch und Blut zu übersetzen. Seine Botschaft heißt: So viel bist Du mir wert! Je mehr wir Jesus Christus kennen, werden wir entdecken, dass sein Weg wahr ist und uns Leben schenkt. Der Hirte Jesus Christus sagt: ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Vgl. Joh10,10. Der Anfang ist schon gemacht. Jedesmal wenn ein Mensch sagt: ich bin eine Christin, ein Christ, dann heißt das soviel wie sagen: Diesen Anfang lasse ich nie mehr los. Und ich mache weiter damit.
Stefan Notz
3. Sonntag der Osterzeit
Das Leben hat zwei Seiten, die uns in Bewegung halten: die eine Seite ist der Misserfolg und die andere Seite ist der Erfolg. Enttäuschung und Glück. Das eine wehren wir ab, weil es uns schockt, dem anderen halten wir die Hände entgegen. Beide Seiten des Lebens kann ich als Bewährungsproben des Glaubens verstehen. So möchte ich die Erfahrung der Jünger am See von Tiberias (Joh 21,1-14) deuten. Sie befinden sich mit Petrus auf dem See und sind enttäuscht: Sie haben nichts gefangen. Was denken diese erfahrenen Fischer? Welche Gefühle haben sie angesichts der leeren Netze? Ich weiß es nicht. Der Evangelist berichtet, dass eine Wende eintritt als der Herr zu ihnen kommt und sie um etwas zu essen bittet. Das trifft sie erneut, denn sie haben nichts und das zeigt erneut ihre ganze Ohnmacht. Christus überwindet ihre Verlegenheit. Er ruft ihnen zu das Netz erneut auszuwerfen. Da erkennt Johannes den Herrn und sagt es Petrus. Der ist außer sich und springt in den See. Alles hat sich gewandelt. Die Enttäuschung ist wie weggeblasen die Netze, die sie ins Boot ziehen, sind voll. Was für ein eindringliches Zeichen für die einzigartige, unfassbare Überlegenheit des Herrn. Er kann Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung wenden. Wir erleben heute viel Unsicherheit angesichts der Krisen und Gefährdungen in der Welt, in der Gesellschaft und in unserer Kirche. Ich vertraue darauf, dass Jesus kommt – auch heute. Er lädt uns ein: Kommt und esst. Schön, wenn wir wie die Jünger nicht zu fragen wagen: Wer bist du? Denn wir dürfen uns freuen: Es ist der Herr!
Stefan Notz
2. Sonntag der Osterzeit
Der Sonntag nach dem Osterfest heißt traditionell Weißer Sonntag und erinnert an die weißen Taufkleider, die in der frühen Kirche den Täuflingen während der Osternacht angelegt wurden. In vielen Gemeinden war der Weiße Sonntag mit der Feier der Erstkommunion verbunden – und ist es hier und da auch heute noch.
Taufe und Eucharistie gehören zusammen. In den Sakramenten der Hl. Taufe und der Hl. Eucharistie wird die Gemeinschaft mit Jesus Christus grundgelegt und gefestigt. Durch die Taufe sind wir mit Christus getauft auf seinen Tod, um mit ihm zum Leben aufzuerstehen, wie der Apostel Paulus verkündet. In der Feier der Heiligen Messe vertiefen wir unsere Verbindung mit Christus durch den Empfang der Hl. Kommunion und haben damit Anteil an seiner Lebenshingabe an uns Menschen.
Heute höre ich öfter sagen: „Irgendwie glaube ich an Gott. Aber das mit der Auferstehung nehme ich dir nicht ab.“ Nun, beweisen kann ich unseren Glauben an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten nicht. Ich bin und bleibe aber ein fragender Mensch und bin froh, dass es den Apostel Thomas gibt, der im Johannes-Evangelium zum Glauben an die Auferstehung findet, weil er die Wunden des Auferstandenen berühren kann.
Der Glaube bekennt, dass der Gekreuzigte identisch ist mit dem Auferstandenen. Alles, was Jesus getan, gesagt und gewirkt hat, ist auf Golgotha nicht gestorben, sondern lebendig. Ich finde, beim Glauben ist es wie mit der Liebe. Wer sich auf den anderen wirklich verlässt, braucht keine Liebesbeweise mehr. Weil die Liebe ja schon längst da ist.
Stefan Notz
14. Sonntag im Jahreskreis
„Komm, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt.“ (Mk5 23) - Gott hält sich nicht distanziert von Leid und Tod.. Er lässt sich hineinziehen in unsere Wirklichkeit, wo gelitten und gestorben wird. Er lässt uns nicht allein damit. Wir sehen als Glaubende Sterben und Tod in einem anderen Licht. Wir dürfen annehmen, dass Gott auch in den dunklen und dunkelsten Stunden bei uns ist. Das ist die Antwort des Evangeliums auf die lastende Frage nach Tod und Leid. Beides wird dadurch nicht abgeschafft – weil zumindest das Sterben natürlicherweise zu unserem Leben gehört. Aber wir können anders umgehen mit beidem: wir werden nicht fortgerissen aus Gottes Hand. Das lässt sich, denke ich, nur erbeten. Und dann erfahren. Und vielleicht erzählen. Ich wünsche mir und Ihnen diese Hoffnungskraft.
Stefan Notz
(in der Zeit der Sommerferien Juli/ August mache ich eine Pause mit den Gedanken zum Sonntag. Allen eine gute Sommerzeit und – hoffentlich – Zeit zur Erholung. Propst Notz)